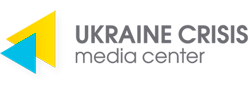Jedes Jahr am 26. April erinnert die Ukraine an die Tragödie von Tschernobyl. Es ist die größte Umweltkatastrophe des Landes, die vor 32 Jahren globale Ausmaße angenommen hatte. Wie sieht es heute in der Sperrzone um das damals explodierte Kernkraftwerk aus? Warum gibt es Warnungen vor einem “zweiten Tschernobyl” im Donbass? Fakten vom Ukraine Crisis Media Center:
Die neue Schutzhülle
Den Blick auf das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl prägt heute eine neue Schutzhülle in Form eines riesigen Bogens. Sie steht über dem sogenannten “Sarkophag” aus Beton. Er wurde im April 1986 über dem durch eine Explosion zerstörten vierten Reaktorblock des Atomkraftwerks Tschernobyl errichtet. Der Bau der neuen Schutzhülle begann im Jahr 2012. Sie ist 257 Meter breit, 150 Meter lang und 108 Meter hoch. Ihr Gewicht beträgt rund 29.000 Tonnen. Fertig war die neue Hülle vor anderthalb Jahren. Am 29. November 2016 wurde die riesige Konstruktion über den “Sarkophag” geschoben. Die Hülle soll für die nächsten 100 Jahre Schutz vor dem baufälligen “Sarkophag” bieten, unter dem sich radioaktives Gerät, Abfälle und Staub befinden. Die Schutzhülle, auch unter der Bezeichnung “New Safe Confinement” bekannt, zeigt Wirkung. Nach Angaben des dort tätigen Personals herrschen in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks inzwischen solche Strahlenwerte, dass sich Menschen dort bis zu zehn Stunden aufhalten können, ohne die zulässige Tagesdosis an Radioaktivität zu überschreiten.

Ideale Straßen in der Sperrzone
Das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl ist von einer 30-Kilometer-Sperrzone umgeben. Die Straßen in der Zone sind in einem sehr guten Zustand. Im Unterschied zu vielen Straßen in der Ukraine haben sie keine Schlaglöcher. Sie sind mit einer gleichmäßigen Asphaltschicht bedeckt damit bei Transporten keine radioaktiven Gegenstände und Stoffe verschüttet werden können. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit für LKWs beträgt dort 40 Stundenkilometer.
Die “Heimkehrer” und die unsichtbare Strahlung

Nach der Zwangsräumung vor über 30 Jahren waren einige der ehemaligen Bewohner der Gegend um das Atomkraftwerk wieder in ihre Häuser zurückgekehrt. Heute leben dort rund 150 Menschen. Im Laufe der Zeit haben sie sich daran gewöhnt, nicht mehr an die Strahlung zu denken. Die meisten sind zu der Überzeugung gelangt, dass sie persönlich von der Gefahr, wenn sie überhaupt bestehe, gar nicht betroffen seien. Die radioaktive Gefahr fürchten die Menschen in Tschernobyl weniger als eine mögliche Zwangsumsiedlung. Meist sagen sie, in der Zone gebe es gar keine Strahlung. Überraschenderweise gibt es unter den Heimkehrern wenige Krebsfälle, vor allem im Vergleich zu den sogenannten “Liquidatoren”, die in den Jahren 1986 und 1987 zur Bekämpfung der Katastrophe am havarierten Atomblock eingesetzt wurden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass geringe Strahlendosen über einen langen Zeitraum weniger gefährlich sind als starke Strahlung über einen kurzen Zeitraum.
Verkleinerung der Sperrzone und ein Naturschutzgebiet
Immer wieder wird geprüft, ob die Sperrzone verkleinert werden kann. Einem vom Parlament beschlossenen Programm zufolge soll das stillgelegte Atomkraftwerk Tschernobyl bis zum Jahr 2065 vollständig beseitigt werden. So soll der Kernbrennstoff geborgen und in ein Endlager gebracht werden. Die restlichen Reaktoren sollen zurückgebaut werden, wenn die Strahlung es irgendwann erlaubt. Danach soll das Gebiet dekontaminiert werden. Obwohl die Sperrzone offiziell eine klar festgelegt Grenze hat – 30 Kilometer um den Reaktor – ist sie dennoch ziemlich verschwommen. Denn nach dem Unglück wurde die Grenze willkürlich festgelegt. Damals gab es außerhalb der Zone sogar stärker verseuchte Gebiete als innerhalb der Zone. Außerdem sind in letzter Zeit verstärkt Vorschläge zu hören, die mehr oder weniger sicheren Landstriche wieder zu nutzen – so könnte beispielsweise ein Biosphärenreservat eingerichtet werden. In der Sperrzone leben schon heute etwa 400 Arten von Tieren, Vögeln und Fischen. 60 davon stehen auf der Roten Liste. Das Gleiche gilt für die Pflanzenwelt. Von 1200 in der Zone gefundenen Arten gelten 20 als selten. Gesichtet wurde auch schon die seltenen Schwarzstörche und Waschbärhunde.
Sonnenkraftwerk in Tschernobyl
In der Sperrzone soll in Zukunft auch wieder Strom produziert werden, mit einem Sonnenkraftwerk, das ein durchschnittliches ukrainisches Dorf mit rund 2000 Häusern mit Strom versorgen kann. Seine Leistung soll ein Megawatt betragen. Entsprechende Baupläne hatte die ukrainische Regierung potentiellen Investoren im März 2017 zukommen lassen. Die Staatliche Agentur der Ukraine, die für die Sperrzone zuständig ist, schrieb einen Wettbewerb unter den Unternehmen aus, die das Sonnenkraftwerk bauen wollten. Über 50 Firmen aus Dänemark, den USA, China, Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Belarus beantragten Flächen für den Bau und Betrieb von Solaranlagen in der Sperrzone. Den Wettbewerb gewann die private Firma Solar Chornobyl LLC, die in einem Konsortium mit der ukrainischen Firma Rodina und der deutschen Enerparc AG zusammenarbeitet. Im Oktober 2017 begann sie mit dem Bau, in den rund eine Million Euro flossen. Nach nur einem Monat war die Anlage fertig – rund 100 Meter von der neuen Schutzhülle entfernt auf einer Fläche von 1,6 Hektar. Ende 2017 sollte sie in Betrieb gehen. Doch seit fast einem halben Jahr kann das Sonnenkraftwerk aufgrund bürokratischer Verzögerungen nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.
Tschernobyl in Musikvideos
Viele ausländische Touristen, Forscher und Künstler zieht es in die Sperrzone. So präsentierte die Kultband Pink Floyd 2014 einen Clip zum Song “Marooned”, der in der Geisterstadt Prypjat nahe dem Atomkraftwerk Tschernobyl gedreht wurde. Er wurde über 20 Millionen Mal auf dem YouTube-Kanal der Band angeschaut.
Tschernobyl ist auch Teil des Kurzfilms des schottischen Pop- und Rock-Sängers Paolo Nutini. Der Clip wurde für das Lied “Iron Sky” gedreht. Das Video wurden mehr als zwei Millionen Mal geklickt.
Droht ein zweites “Tschernobyl” im Donbass?

Seit April 2018 wird aus der Junkom-Mine (Junyj Komunar) im Gebiet der sogenannten “Volksrepublik Donezk” kein Wasser mehr abpumpt. Die prorussischen Separatisten haben sich für eine billige und einfache Lösung bei der Stilllegung der Mine entschieden. Sie berufen sich dabei auf Einschätzungen russischer Experten. Ukrainische Experten hingegen meinen, dass die Flutung der Mine eine Umweltkatastrophe – ein “zweites Tschernobyl” – auslösen könnte. In der Mine befinden sich in einer Tiefe von 903 Metern radioaktive Stoffe. Mehr über die Umweltgefahren, die von der Mine ausgehen, in einem Special des ukrainischen TV-Sender “Hromadske” in englischer Sprache.