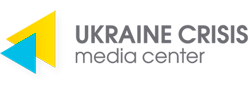Noch vor zwei Jahren wohnten Alisa Kowalenko und Ljuba Durakowa in einem Studentenwohnheim in Kiew, lernten Dokumentarfilme zu drehen und machten Aufnahmen vom Maidan.
Heute sind sie die Regisseurinnen des Dokumentarfilms „Alisa in Warland“, der vom Krieg im Donbass handelt. Der Film wurde beim Dokumentarfilmfestival in Amsterdam gezeigt, sowie beim „Artdokfest“ in Moskau.
Darüber, wie sie der Film veränderte, welche Schrecken sie im Krieg erlebten, sowie über die Gefangenschaft in der „DVR“ und die Wahrnehmung des Films in Moskau, geht es in dem Exklusivinterview für UCMC.
Was wollten Sie mit diesem Film erzählen? Wie veränderte dieser Film Ihre Wahrnehmung, was im Land geschieht?
Alisa Kowalenko: Mir scheint, der Film geht über das Erwachsenwerden. Nicht nur über mein eigenes Erwachsenwerden, sondern auch das von jedem von uns – der Soldaten, der Freiwilligen oder unserer Freunde vom Maidan. Der Film geht darüber, wie ein Mensch eine Entscheidung trifft, begreift, dass diese einen Preis hat und dass er für sein Handeln verantwortlich ist.
Im Verlauf der Dreharbeiten, die zum Großteil an der Front stattfanden, war es mir wichtig, meine Rolle vor dem Hintergrund all dieser Ereignisse zu verstehen. Ich stellte mir die Frage, ob ich in erster Linie Regisseur bin oder trotzdem Zivilist. Es ist schwierig, an der Front eine emotionale Distanz zu wahren, denn man ist zu sehr in die Ereignisse verwickelt.
Die Menschen, die ich an der Front, in Pisky aufnahm, waren fast alle keine Berufssoldaten. Es waren Leute, die zu den Freiwilligenbataillonen gingen, weil sie der ukrainischen Armeeführung nicht vollständig vertrauten. Sie gingen, um die Ukraine zu verteidigen. Einer meiner Protagonisten, der „Mönch“, sammelte in einem Dorf Geld für eine schusssichere Weste. Das ganze Dorf schickte ihn in dieser schusssicheren Weste an die Front, mit Gurken und Tomaten. Die meisten Kämpfer, wie auch ich, studierten gestern noch an der Universität oder hatten ein eigenes Unternehmen. Viele hatten studiert. Wenn man lange mit ihnen dreht, fragt man sich: „Und wer bin ich? Oder soll ich auch etwas machen?“
Gerade deshalb ist es ein persönlicher Film. Es war nicht unsere Aufgabe, Fakten zu analysieren, sondern das zu erzählen, was wir fühlten.
Ljuba Durakowa: Als wir an der Filmfachschule studierten, stritten wir darüber, was Realität ist. Auf dem Maidan drehte ich im Februar 2014 einmal, wie Alisa Benzin für Molotow-Cocktails bringt. Das war eigentlich das erste Mal, als ich verstand, dass ich nicht einfach nur Regisseurin bin, sondern auch etwas machen muss. Dann legten einige unserer Mitstudenten ihre Kamera beiseite und fingen zum Beispiel an, Borschtsch zu kochen, Autoreifen zu bringen oder Butterbrote zu schmieren. Letztlich geht unser Film für mich über die Verzweiflung eines Menschen, in dessen Land Krieg herrscht.
Alisa, Sie sind sowohl Regisseurin als auch Hauptperson des Films. Im Film gibt es eine Szene, wo Sie die Hand an der Waffe haben und schießen. Wieso? Was unterscheidet einen Dokumentarfilm von Journalistik?
Alisa: Ich denke, der wesentliche Unterschied zwischen einem Journalisten und Dokumentarfilmer ist die Distanz. Für einen Journalisten besteht die Grenze darin, was er tut. Die Grenze, die er nicht überschreiten darf, verläuft zwischen Objektivität und Engagement. Für mich als Dokumentarfilmerin hörte diese Grenze irgendwann auf zu existieren. Allerdings kann ein Dokumentarfilmer seine Grenze selbst definieren. Während der Dreharbeiten wollte ich für mich wissen, wie weit ich gehen kann, um dieses Leben im Krieg zu verstehen und vollständig zu fühlen; wie lange ich es unter den Leuten an der Front aushalte. Wenn man sich dazu entscheidet, geht man an seine eigenen Grenzen zwischen Schmerz und Reflexion. Ich hatte Phasen, als es für mich psychisch äußerst schwierig war, dort zu bleiben, doch ich blieb jedes Mal.
An der Front hielten mich auch meine Helden. Um Menschen im Krieg zu drehen, muss man einen Teil ihres Lebens miterleben und auch durch schwierige Situationen gehen. Die Hauptsache im Krieg ist der Mensch, nicht der Soldat. Es kann passieren, dass man viel Zeit mit jemandem verbringt und nichts geschieht. Und dann, plötzlich, kommt der Mensch heraus, der von seinem kleinen Kind erzählt. Und das zeigt der Film.
Ljuba: Dokumentarfilme sind immer persönliche Geschichten. Wenn man einen Helden findet, bleibt man bei ihm. Einen solchen Film kann man nicht in 2 oder 3 Tagen drehen. Dokumentarfilme erfordern im Gegensatz zu Journalistik einen langen Prozess. Oft ist ein neuer Film erst nach einigen Jahren fertig.
Im Film gibt es Fragmente vom Maidan, die hauptsächlich Ljuba drehte. Aber dem Teil über den Krieg, den Alisa aufnahm, ist mehr Zeit gewidmet. Alisa, wann fingen Sie an, direkt im Krieg zu filmen?
Alisa: Ich fuhr bereits im Frühling 2014 in den Osten. Damals war ich längere Zeit an einem Checkpoint zwischen Slowjansk und Kramatorsk. Für mich eröffnete sich ein vollkommen neuer Mikrokosmos, der an dem Checkpoint entstanden war. Dort gab es Leute von Berkut, die auf dem Maidan schossen, sowie Leute von der Nationalgarde. Sie kamen aus Lwiw und aus Luhansk. Viele der Soldaten, die an dem Checkpoint waren, verstanden überhaupt nicht, warum sie dort sind und was geschieht.
Einer von ihnen, der „Separatist“ genannt wurde, weil seine Eltern aus Luhansk stammten, telefonierte oft mit seinem Vater. Der Vater sagte dann immer zu ihm, dass er selbst kommen und ihn eigenhändig erschießen wird.
Ein anderer Soldat aus Donezk hielt es nicht aus und eines Nachts ging er einfach. Er wechselte auf die andere Seite, zur „DVR“, mitsamt seinen Waffen und seiner Ausrüstung.
Im Film gibt es eine Episode, in der Sie erzählen, wie Sie in Gefangenschaft gerieten und was dort geschah. Können Sie sagen, um was es geht?
Alisa: Bis heute mache ich die Ohren zu, wenn ich diesen Ausschnitt sehe. Im Mai 2014 kam ich wieder zu dem Checkpoint. Ein Taxi brachte mich nur zum ersten Checkpoint der „DVR“. Zu der Zeit arbeiteten viele Taxifahrer mit den Separatisten zusammen. Der Fahrer sagte ihnen: „Sie ist von der ukrainischen Armee.“ Sie verhörten mich zirka eine Stunde und brachten mich dann zur Verwaltung in Kramatorsk. Die Frauen, die dort waren, wollten mich den ganzen Weg über schlagen, doch der Mann, der mitfuhr, sagte, dass sie das nicht dürfen.
Dort herrschte eine wirkliche Aggressivität und ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte. Dann wurde ich die ganze Nacht verhört. Sie behaupteten, mich in einer Uniform gesehen zu haben, dass ich Ziele auskundschaftete, dass ich eine Scharfschützin wäre, oder beides zusammen. Sie drohten mir, dass wir zu den Eltern von gefallenen Soldaten in der „DVR“ fahren.
Während des Verhörs klingelte mein Telefon. Das war die Melodie „Indem wir den Feind schlagen, überwinden wir unsere Not“. Dann begannen russische Soldaten mit meinem Telefon herumzulaufen und sie schrieen: „Seht her, wen wir gefangen haben! Sie will uns alle umbringen!“
Ich konnte kaum unterscheiden, was davon ernst war, und was Einschüchterung. Sie machten mir mit allem Angst, was nur möglich war. Dass sie mir die Finger brechen würden, weil das normal sei. Sie meinten, ich solle die ukrainischen Soldaten anrufen und ihnen sagen, dass sie nach Hause gehen sollen, weil niemand diesen Krieg brauche.
Vier Tage war ich in Gefangenschaft. Ich wurde mit Maschinengewehren bewacht. Hinter mir saßen zwei Kerle, die untereinander scherzten: „Wir jagen ihr einen Schrecken ein oder provozieren sie. Lassen wir Sie laufen und dann schießen wir ihr in die Beine. Das wird ein Spaß.“ Solche Witze machten sie.
Ljuba: Alisa und ich sprachen viel darüber. Sie brauchte über ein halbes Jahr, um mit diesem Erlebnis klar zu kommen. Letztlich fand Alisa ihren Mut in dieser Szene im Film wieder. Das jetzt zu erzählen, ist schwierig. Besser, man schaut sich den Film an.
Gibt es im Film Szenen vom Donezker Flughafen? Ich weiß, dass Sie die als einzige Frau dort waren, als es am heißesten war. Wie kam es dazu?
Alisa: Ich war im Oktober 2014 für zwei Tage am Flughafen. Zu der Zeit war ein Teil des neuen Terminals unter ukrainischer Kontrolle; der andere Teil gehörte zu den Separatisten. Der Krieg fand zwischen den Stockwerken statt. Das alte Terminal wurde von der Ukraine, dem „Rechten Sektor“ kontrolliert. Ich kam im neuen Terminal an und über Nacht wechselten wir ins alte. Man konnte nur nachts rüber, weil auf dem Gelände immer geschossen wurde. Ich hatte sogar im Panzer Angst, denn wenn ein Geschoss den Panzer trifft, kommen alle darin um. Es war aber nicht so schlimm, am Flughafen zu sein, sondern dorthin zu kommen. Im Film gibt es eine Szene über die Ankunft am Flughafen.
Was ist das schlimmste am Krieg?
Alisa: Die Kälte. Man gewöhnt sich an den Beschuss. Ich war im Flughafen am Posten „Himmel“ – das ist ein Eisenturm, so hoch wie ein 10-stöckiges Haus in Pisky. Ich war dort im Dezember 2014. Wir wurden mit Mehrfachraketenwerfer und Minen beschossen. Alle lagen auf dem Boden und ich dachte, dass es das Ende ist. Der Turm schwankte und ich hatte das Gefühl, dass er jeden Augenblick einstürzt.
Um auf den Turm zu kommen, musste man über eine Treppe, aber so schnell wie möglich, denn es gab ständig Scharfschützen. Man läuft auf allen Vieren, in einer schusssicheren Weste und mit Helm. Und dann kommt die Kälte. Wenn man eine ganze Nacht im Dezember dort sitzt, ist es schrecklich. Nichts hilft mehr gegen die Kälte. Man hört auf zu denken, kann nicht schlafen. Im Film gibt es von dort keine Bilder, sondern nur den Ton – den Beschuss.
Wie war die Reaktion des Publikums beim Dokumentarfilmfestival in Amsterdam?
Alisa: Der Saal war voll. Die Zuschauer nahmen den Film sehr warm auf. Zu mir kam ein Mann, der mir erzählte, dass sein Friseur aus der Ukraine stammt. Er fragte mich, wann der Krieg zu Ende sei. Ich sagte ihm, dass ich das leider auch nicht sagen kann. Er war sehr verwirrt und meinte: „Was werde ich jetzt meinem Friseur sagen?“
Sie zeigten den Film auch beim „Artdokfest“ in Moskau. Wie waren Ihre Eindrücke von der Reise?
Alisa: Als wir uns mit Vitalij Manskij, dem Organisator des „Artdocfests“, in Amsterdam trafen, fragte er mich, ob ich kommen werde. Ich hatte Zweifel, weil ich dachte, dass es gefährlich werden könnte, denn im Film gibt es eine Szene, wo ich zusammen mit Soldaten des „Rechten Sektors“ stehe und mit einem Maschinengewehr schieße. In Russland ist der „Rechte Sektor“ verboten.
Aber trotz meiner Befürchtungen ging ich nach Moskau und alles war OK. Wir unterhielten uns mit Leuten, die uns ähnlich sind und wir verstanden uns sehr gut.
Ich war mehr überrascht, als ich am 12. Dezember, dem „Tag der Verfassung“, in Moskau auf den „Marsch der Änderungen“ ging, der von der Opposition in Moskau organisiert wurde. An dem Tag wurden zirka 70 Personen verhaftet. Sie wollten gegen 14 Uhr vom Puschkin- zum Sacharow-Prospekt ziehen, aber wurden bereits verhaftet, bevor sie überhaupt losgehen konnten.
Als ich mit etwas Verspätung zu der Kundgebung kam, waren dort nur noch ein paar Leute. Wir gingen zusammen zur Miliz, um den Gefangenen etwas zu Essen zu bringen. Dabei stellte sich heraus, dass ein älterer Herr aus der Ukraine zu der Kundgebung kam. Das heißt, er kam extra aus der Ukraine nach Moskau, um an der Kundgebung teilzunehmen. Das machte mich betroffen. Frauen hatten Bänder in den Farben der ukrainischen Flagge. Das berührte mich auch, dass es Leute gibt, die verstehen, dass sie sobald sie auf die Straße gehen, verhaftet werden und trotzdem gehen sie auf die Straße. Noch gibt es in Russland solche Festivals wie das Artdocfest und noch gibt es Leute, die auf solche Kundgebungen gehen. Noch gibt es Hoffnung.
Ljuba: Mich berührte etwas anderes. Ich ging nach Russland und fuhr mit dem Bus nach Charkiw zurück. Als ich an der russisch-ukrainischen Grenze war, ging ich zu Fuß. Das war einfach schneller, weil es eine lange Schlange mit Bussen gab. Man konnte auch zu Fuß gehen und in der Ukraine dann ein Taxi bis nach Charkiw nehmen. Als ich auf der russischen Seite zur Grenze ging, fragte ich einen russischen Grenzsoldaten, ob ich auf dem richtigen weg sei. Er zeigte Richtung Ukraine und sagte: „Richtig, nach Europa geht es da lang.“