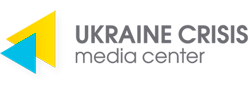Oberst Oleh Drus, Leiter der Psychiatrie im Zentralen Militärhospital, hat mit einer Äußerung für heftige Empörung in der ukrainischen Öffentlichkeit gesorgt. Am 18. September hatte er auf einer Sitzung des Parlamentarischen Ausschusses für Gesundheit gesagt, dass 93 Prozent derjenigen, die in der Zone der Anti-Terror-Operation (ATO) im Donbass im Einsatz gewesen seien, eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen könnten. Die gesellschaftliche Organisation “Informations- und Koordinierungszentrum” sowie das Ukraine Crisis Media Center haben daraufhin Psychologen, ATO-Veteranen, Psychiatern und Angehörigen der Streitkräfte angeboten, bei einem Runden Tisch darüber zu sprechen, wie es um die Psyche der Menschen steht, die an Kämpfen beteiligt waren. Davon gibt es in der Ukraine inzwischen mehr als 300.000.
Betroffene verstecken sich
Jewhenija Hrynewytsch, Mitarbeiterin eines mobilen Armee-Krankenhauses, nahm während des Runden Tisches Oleh Drus in Schutz und erläuterte, der Oberst habe deutlich machen wollen, dass 93 Prozent der Soldaten ihre Symptome für eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) verstecken und sich nicht an Fachleute wenden würden. Zu einem solchen Ergebnis seien PTBS-Studien über Kriegsveteranen anderer Ländern gekommen, die zum Beispiel in Afghanistan, im Irak und in Israel im Einsatz gewesen seien. Genaue Zahlen, wie viele ATO-Veteranen in der Ukraine unter psychischen Störungen leiden, liegen allerdings nicht vor.
Olexandr Sborowskyj von der ukrainischen Nationalen Akademie für Medizinische Wissenschaft sagte, eine posttraumatische Belastungsstörung bilde sich nach etwa vier bis sechs Monaten nach Ende der traumatisierenden Einflüsse heraus. “Das ist ein ganzer Komplex von Symptomen”, sagte er.
Eine posttraumatische Belastungsstörung entstehe aber nicht unbedingt bei jedem, der Erfahrung mit Krieg gemacht habe, erläuterte Oleh Tschaban von der Kiewer Bohomolez-Hochschule für Medizin. “Meist kommt es zu akuten Stressreaktionen, die bei rechtzeitiger psychologischer Hilfe wieder vorbeigehen”, sagte er. Ihm zufolge müssen Menschen, die in den Krieg ziehen, aggressiv sein. Das sei generell typisch für Militärs. “Aber deren Aggression ist gegen den Feind gerichtet. Wir haben allerdings herausgefunden, dass es eine versteckte Aggression gibt, die sich gegen Freunde und Angehörige der Soldaten richtet”, so Tschaban.
Außerdem fanden ukrainische Forscher heraus, dass sich bei Frauen, die im Krieg waren und dazu neigen, ihre Emotionen zu unterdrücken, die posttraumatische Belastungsstörung auf somatischer Ebene manifestiert. Bei ihnen sei die Wahrscheinlichkeit groß, Probleme bei der Fortpflanzung zu bekommen. Oksana Hawryljuk, Leiterin des “Informations- und Koordinationszentrums”, sagte, in einigen Armeeeinheiten betrage der Anteil von Frauen über zehn Prozent. “Aufgrund von Studien haben wir dem Generalstab vorgeschlagen, einen Leitfaden mit Informationen zu erarbeiten, den Frauen erhalten sollten, wenn sie bei der Armee einen Vertrag unterzeichnen”, berichtete Hawryljuk.
Noch mehr Betreuung nötig
Serhij Hryljuk, der bei den Streitkräften die Abteilung leitet, die für psychologische Unterstützung zuständig ist, sagte während des Runden Tisches, dass es heute in jedem Bataillon der ukrainischen Armee einen Psychologen gebe. Vor einer Demobilisierung würden die Soldaten eine erste psychologische Hilfe erhalten. “Das Problem ist jedoch, dass es keine Betreuung mehr gibt, wenn der Soldat aufhört, Soldat zu sein”, erläuterte Hryljuk.
Der Militärpsychologe und Veteran Andrij Kosintschuk kritisierte, dass es kein einheitliches System gebe, um demobilisierten Soldaten helfen zu können. “Daher kommt es zu Chaos und Missverständnissen zwischen staatlichen Organen und den ATO-Teilnehmern”, sagte er. Ein großes Problem sei, dass unter Veteranen Misstrauen gegenüber Psychologen und Psychiatern herrsche.
Auch Journalisten betroffen
Nicht nur bei Angehörigen der Streitkräfte, sondern auch bei Journalisten und Freiwilligen, die in der Konfliktzone im Einsatz waren, gibt es Probleme bei der psychischen Anpassung an das zivile Leben. “Die Lage von Journalisten ist besonders schwierig. Erstens sind Journalisten oft Zeugen von Ereignissen und zweitens haben sie es meist mit betroffenen Menschen zu tun – mit Kindern, Militärs und Binnenflüchtlingen”, erklärte Maryna Beskorowajna, die OSZE-Projekte für Medienentwicklung in der Ukraine leitet. Ihr zufolge stehen Journalisten zusätzlich unter psychischem Druck, weil sie ihre Gefühle “ausschalten” müssen. Das könne zu einem psychischen Trauma führen, so Beskorowajna.
Vor kurzem führte das Koordinierungsbüro für die OSZE-Projekte in der Ukraine zusammen mit Experten des Psychologischen Krisendienstes eine anonyme Online-Umfrage unter Journalisten durch. Dabei wurden sie zu den Ereignissen im Donbass befragt. Von den 52 Journalisten (Männer und Frauen gleichermaßen) haben 70 Prozent unmittelbar in der Konfliktzone gearbeitet. 25 Prozent haben mit Opfern des Krieges zu tun gehabt. “Die meisten Befragten leiden unter Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und aggressiven Anfällen. Viele möchten Menschen meiden und allein sein. Sie sind gereizt”, sagte Beskorowajna über die Ergebnisse der Umfrage.